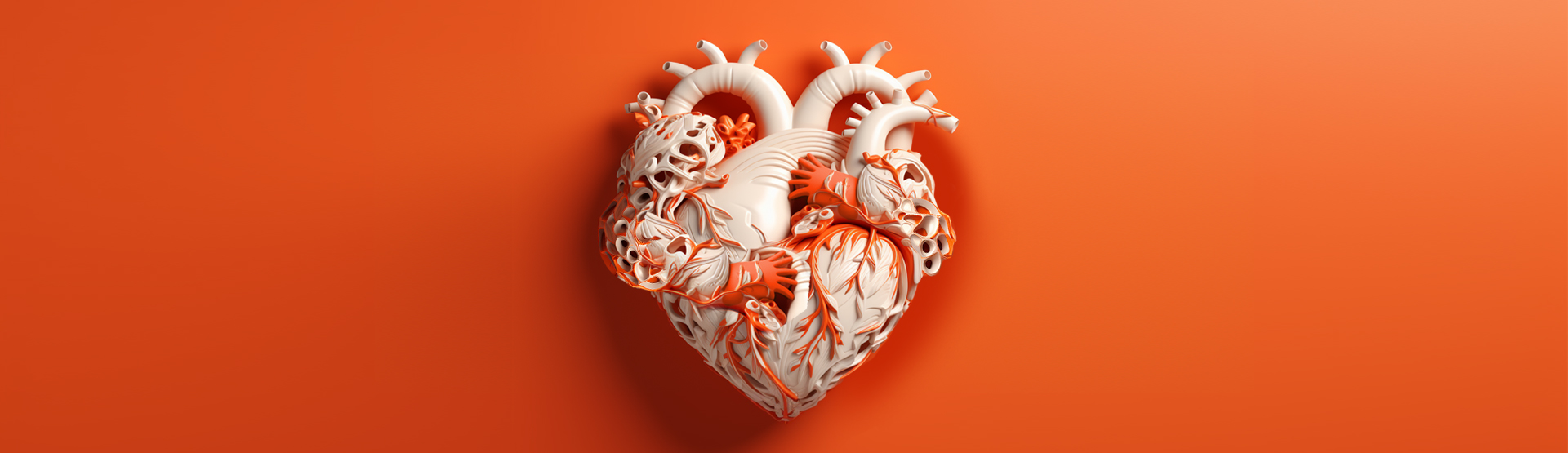
Trendscout
Wo sind die Pharmakampagnen mit Herz?
Ärzte denken nicht nur, sondern fühlen auch
In der Medizin wird kühl kalkuliert, nur der Blick auf die Zahlen zählt. Stimmt das? Schließlich entscheiden Menschen auch mal aus dem Bauch heraus. Die einstmals als Halbgötter in Weiß verehrten Ärzte sind da keine Ausnahme. Statt rein rational zu argumentieren, sollten Pharmamarken auch deren Emotionen ansprechen. Ein Plädoyer für mehr Kampagnen, die ans Herz gehen.
Schon gehört?
Diesen Beitrag gibt´s auch als Blogcast.
„No one ever made a decision because of a number. They need a story.“ So Daniel Kahneman. Er könnte recht haben, schließlich machen Geschichten Abstraktes – wie zum Beispiel Zahlen – erst erlebbar, und was wir erleben, das vermag uns stärker zu beeinflussen als reine Fakten, von denen wir nur Notiz nehmen. Wir glauben zwar gern, dass unsere Entscheidungen immer rational sind, auf Zahlen und Fakten basieren, doch die meisten werden unbewusst getroffen – in 95 % der Fälle, sagt die Neurowissenschaft. Das betrifft uns alle. Auch die Ärzteschaft. Pharmamarken sollten ihr Bild vom rein rationalen Mediziner überdenken, emotionale Geschichten erzählen und bewegen. Dann entscheiden sich Ärzte in Zukunft aus Sympathie vielleicht für sie.
Das erwartet Sie hier:
- Warum Ärzte auch Emotionen haben
- Welche Auswirkungen Sympathie beim Arzt hat
- Warum Pharmamarken mehr als Fakten brauchen
Gefühl vs. Verstand: Ärzte sind auch nur menschlich
Spock aus Star Trek ist kein Arzt, er ist Vulkanier – aber genauso stellen wir uns Ärzte oft vor: Reine Vernunftwesen, die Entscheidungen nur aufgrund von Zahlen, Daten und Fakten treffen. Platz für Emotionen? Nicht, wenn es um Gesundheit geht. Doch Spock ist halb Mensch, er hat Gefühle! Auch wenn Ärzte manchmal distanziert wirken, eine nüchterne und analytische Art an den Tag legen – sie sind menschlich! Das mag banal klingen, wird aber anscheinend diskutiert: „Wie menschlich darf ein Arzt sein?“
Pharmamarken haben die menschliche Seite des Arztes ebenfalls noch nicht vollständig erkannt. Während man sich teilweise in die Gefühlswelt der Patienten hineinversetzt und sie emotional anspricht, OTC-Präparate gefühlvoll inszeniert und so Sympathien zu wecken versucht, bekommen Ärzte selten mehr als medizinische Fakten und Statistiken. Der Gedanke dahinter: Studienergebnisse sprechen für sich. Doch wie fühlt sich eigentlich der Arzt?
Dabei bezweifelt niemand die Aussagekraft von Zahlen. Doch Menschen sind keine gefühllosen Computer, die am laufenden Band Berechnungen anstellen. Vor allem Ärzte nicht. Sie müssen zu einem gewissen Grad emotional sein: Zuhören, Verständnis zeigen, Anteil nehmen, Mitgefühl zeigen, sich kümmern. Emotionalität gehört genauso zu ihrem Wesen wie die reine Logik. Spock ist vielleicht kein Arzt, aber jeder Arzt ist ein bisschen wie Spock.
Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, benötigt es eben beides: Gefühl und Verstand. „Die Kunst der Entscheidung“ ist, beides in Einklang zu bringen. So können Ärzte mit ihrer Intuition, dem Bauchgefühl, oft auch richtig liegen. Pharmamarken, die für neue Diagnoseverfahren, Diagnostik-Tools oder innovative Präparate werben, tun daher gut daran, beide Seiten, rationale sowie emotionale, des Arztes anzusprechen.
Sympathie und Antipathie: Die emotionale Praxis der Ärzte
„Sympathie“ bedeutet soviel wie „Mit-Leiden“. Kein Arzt kann allerdings dieselben Leiden wie seine Patienten gebrauchen. Das würde die Behandlung nur unnötig verkomplizieren – ganz zu schweigen vom damit verbundenen Verlust der Objektivität. Geht es um Diagnose und Behandlung, soll der Arzt seine Gefühlswelt unter Kontrolle haben.
Tatsächlich entscheiden Ärzte anders, wenn nicht sie, sondern Patienten betroffen sind. So zeigte 2011 eine Studie der Archives of Internal Medicine in einem fiktiven Szenario, dass Ärzte sich selbst eher einer Behandlung mit hoher Mortalitätsrate unterzögen, wenn die Nebenwirkungen dafür geringer wären. Ihren Patienten würden sie hingegen in den meisten Fällen zu einer Behandlung raten, die eine höhere Lebenserwartung verspreche – allerdings mit stärkeren Nebenwirkungen.
Ärzte wollen, dass ihre Patienten überleben. Dazu haben sie einen Eid geleistet. Manchmal bedeutet das offensichtlich leider, dass Patienten mehr leiden müssen. Platz für Sympathie und eigene Gefühle gibt es da wenig. Risiken müssen abgewogen, Entscheidungen rational getroffen werden. Das ist nicht immer leicht, wie die Triage zeigt.
Doch selbst wenn sie geübt darin sind, Gefühlswallungen auszublenden – auch Ärzte empfinden Sympathie. Oder eben Antipathie. Es gibt schließlich Ärzte, die wir unsympathisch finden. Warum sollten sie uns, die Patienten, immer leiden können? Das bedeutet ja noch nicht, dass sie den Patienten auch „schlecht behandelt“, oder?
Psychologen an der Erasmus-Universität Rotterdam machten dazu ein Experiment. Selbst schwierige Patienten, sog. „Störenfried-Patienten“ – von denen sechs Typen identifiziert wurden –, erhielten demnach dieselbe Aufmerksamkeit, wie die „einfachen“ Patienten. Allerdings: In 47 % der Fälle kam es zu Fehldiagnosen, wenn das Krankheitsbild komplexer war.
Es ist immer schockierend, zu hören, dass Ärzte Fehler machen. Wir wollen uns beim Arzt sicher und aufgehoben fühlen, schließlich haben wir uns dort hinbegeben, weil wir „verletzt“ sind – beim Arztbesuch fühlen wir uns besonders verwundbar. Doch Fehler passieren überall, egal wie trainiert wir auf deren Vermeidung sind. Und Gefühle sind schwer zu kontrollieren.
Die Begründung der Experimentatoren für die Fehleranfälligkeit der Diagnose: Emotionen. Die emotionale Anspannung, die die Begegnung mit dem anstrengenden Patienten verursachte, zerrte an den Kräften der Mediziner, die ihnen bei der Diagnose dann fehlten (Schwierige Patienten erhalten seltener die richtige Diagnose, Medscape). Unangenehme Patienten rauben Ärzten anscheinend die Kraft bzw. die Nerven.
Herz vs. Fakten: Wie man Sympathie weckt
Letztendlich werden also Ärzte unterbewusst davon beeinflusst, ob sie Patienten sympathisch finden. Sicher, sie behandeln ihre Patienten nicht böswillig anders. Wie ein Patient jedoch bei ihnen „ankommt“, hat manchmal Auswirkungen auf die Behandlung. Sie haben weniger Mitgefühl mit unsympathischen Patienten, nehmen ihre Probleme weniger ernst und schätzen ihre Schmerzen falsch ein (Zwei-Klassen-Medizin der Sympathie, Focus). Dazu kam eine Studie der Ghent University in Belgien. Bei Ärzten zählt eben auch der erste Eindruck.
Sympathie und Antipathie spielen somit bei der Arzt-Patienten-Beziehung eine Rolle. Das zeigte auch eine Studie der University of New Mexico, die in der Zeitschrift „Psychologie heute“ (11/2008) besprochen wurde. Gepflegte Patienten erhielten hier tatsächlich weniger Aufmerksamkeit als Patienten, die auf ihr Erscheinungsbild achteten: Die vernachlässigten Patienten wurden weniger gefragt und bekamen auch selbst weniger Raum, um Fragen zu stellen.
All das kann sich negativ auf die Diagnose auswirken. Für Pharmamarken ist diese menschliche Seite der Ärzteschaft jedoch eine Chance. So kommen Pharmakampagnen, die einen sympathischen Patienten in den Fokus setzen, womöglich besser bei Ärzten an. Und sogar solche, die einen auf Anhieb nicht sonderlich sympathischen Patienten darstellen, können den Arzt so sensibilisieren, dass er nicht unterbewusst diskriminiert.
Ein Arzt möchte schließlich allen Patienten gleichermaßen helfen. Das ist nicht nur eine logische Schlussfolgerung, die sich aus seinem Berufsethos ableitet, sondern auch eine emotionale Überzeugung. Tagein, tagaus kämpfen Ärzte mit den Mitteln der Pharmaindustrie für ihre Patienten. Warum sollten sie nicht dankbar für diese Unterstützung sein und Sympathie für eine Pharmamarke entwickeln können? Auch eine Pharmamarke kann durchaus sympathisch rüberkommen – wenn sie nicht nur Fakten, sondern auch Herz zeigen.
Niemand sympathisiert nun einmal mit dem Helden einer Story, weil die Faktenlage es nahelegt. Geschichten gehen ans Herz, weil man sich dort wiedererkennt, „mitleidet“, Sympathie empfindet. Und Sympathie speist sich aus Gemeinsamkeit, Freundschaft, Zusammenhalt und Nähe.
Pharmakampagnen, die ans Herz gehen
Emotionale Kampagnen sind keine Seltenheit:
Da wäre eBay, in dessen Spots Themen wie Freundschaft und Zuneigung eingesetzt werden. Der Klassiker: Der Geburtstagsspot! Er zeigt, wie Sympathie sogar unbelebte Objekte wie eine Piñata lebendig werden lassen kann. Wer fühlt sich da im Herz nicht selbst wieder wie ein Kind?
Oder die Kampagne Puppyhood des Hundefutterherstellers Purina mit seinem Welpenfutter „Puppy Chow“. Genau, Welpenerziehung! Wem geht da nicht das Herz auf?
Doch wo sind die Pharmakampagnen, die Arzt und Ärztin mitten ins Herz treffen?
Es gibt sie tatsächlich!
So zum Beispiel „A Thousand Words About NTM” von Insmed. Die Kampagne, realisiert von Area 23, richtet sich mit kunstvollen Bildern an HCPs. Diese Bilder, entworfen in Zusammenarbeit von Künstlern und Betroffenen, zeigen, wie sich Erkrankte fühlen: Gefangen, ausgeschlossen und als Bedrohung für andere. Da die Erkrankung mit NTM, nichttuberkulöse Mykobakterien, nur schwer diagnostizierbar ist und oft übersehen wird, will die Kampagne Bewusstsein wecken für die Leiden der Betroffenen – und das tut sie auf emotionale Weise, indem sie den Erkrankten eine Stimme gibt, die an das Herz der Ärzteschaft appelliert.
Ein anderes, wenn auch älteres, Beispiel ist Philips „The Longest Night“, produziert von T Brand Studios. Der Fischer im Clip, Páll Pálsson, leidet an Schlafmangel. Und er ist nicht der Einzige: Chronische Fatigue und Schlafapnoe sind Leiden, mit denen fast die Hälfte der isländischen Fischer leben müssen. Es gibt jedoch Abhilfe. Und hier sind die Healthcare Provider gefragt: Sie sollen sich um die Fischer kümmern, sie sind die Zielgruppe, die der Clip treffen will. Es geht nicht um Effizienz und Kosten eines Produkts: Ziel ist es, das Herz der HPs zu treffen. Denn ungeachtet aller anderen Beweggründe wollen diese schließlich eines: Menschen wie Páll Pálsson helfen. So kann B2B-Marketing mit Herz aussehen.
Dass man etwas Herz in Pharmakampagnen bringen kann, zeigt zu guter Letzt das Bayer Präparat Ultravist. Hier wird die Sicht der Zielgruppe selbst, der Radiologen, eingenommen und ihnen sozusagen aus dem Herzen gesprochen.
Mehr Herz wagen ist doch nicht so schwer!
Pharmamarken sollten es wagen, über die Fakten hinauszugehen.
Ich freue mich jetzt schon über Anregungen, Fragen und eine gute Diskussion, um rauszufinden: How to be a Pharma Brand in 2023.
Autor

Michael Vorbrink ist seit 2014 bei antwerpes und hat sich seinen unbefangenen Blick auf die Branche bewahrt: Damals legte er ein Büchlein mit dem Titel „So You Think You Have a Pharma Brand“ an und notierte dort seine Beobachtungen zum Pharma-Marketing. Seitdem sind einige Healthcare-Kampagnen entstanden, in die er seine Erfahrung aus der Arbeit mit T-Mobile, Nestea und der Markenikone Braun eingebracht hat. Er ist Dozent für Markenmanagement an der RFH Köln und will in seinen Beiträgen Spielräume für Healthcare-Marken aufzeigen. – Kontakt
Termin mit Michael Vorbrink vereinbaren
Bildquelle: Midjourney / Prompting: antwerpes
